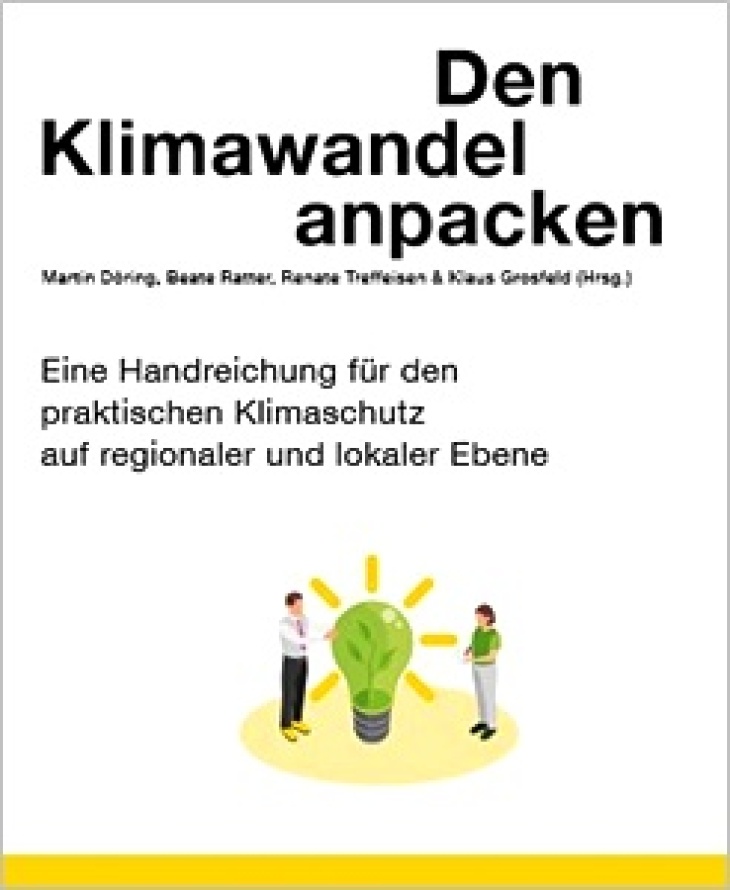Forschung

(Foto: Ina Frings)
In der Abteilung Sozioökonomie des Küstenraumes liegt der Fokus der Forschung auf einem besseren Verständnis der Mensch/Natur-Interaktionen und den Herausforderungen des Umgangs mit Küstenzonen in Zeiten des Klimawandels. Drei Forschungsfelder zeichnen die Abteilung aus: Integriertes Küstenmanagement/Marine Raumplanung, Nutzung und Governance mariner Ressourcen sowie Wahrnehmung von und Anpassung an Umweltveränderungen im Klimawandel. Diese Forschungsfelder werden mit Konzepten wie der Komplexitätstheorie, sozial-ökologischer Systemforschung oder Ökosystemleistungen untersucht. Mit einem speziellen Fokus auf transdisziplinäre Ansätze werden in Kooperation mit Akteuren im Küstenraum unterschiedliche Methoden der empirischen Sozialforschung eingesetzt, u.a. Befragungen, Experteninterviews, Fokusgruppendiskussionen, Feedback-Workshops und Drivers/Response-Assessments.
Handreichung "Den Klimawandel anpacken"
Im Rahmen des klimafit Projekts des REKLIM Verbunds wurde deutlich, dass Klimaschutz weniger eine Frage des Wissens und seiner Umsetzung ist, sondern vielmehr eine Kultur- und Gemeinschaftsaufgabe darstellt. Auf dem in 2022 veranstalteten Symposium „Den Klimawandel anpacken“ wurden verschiedene Themenbereiche bearbeitet, um Vergemeinschaftungen im Klimaschutz für Teilnehmer praktisch erlebbar und nachvollziehbar zu machen. Es wurden Wege getestet, auf welche Art und Weise verschiedene Formen des Klimawissens zu aktivem Klimaschutz motivieren können. Basierend darauf wurde nun eine Handreichung veröffentlicht, die diese Arbeit auf einer empirischen, methodischen und praktischen Ebene dokumentiert.
Handreichung "Den Klimawandel anpacken"
UNESCO-Auszeichnung für „klimafit“
Die UNESCO hat am 08.11.23 den Fortbildungskurs “klimafit – Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?” als eine von 29 Initiativen mit dem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Der „klimafit“-Kurs des REKLIM Verbunds mit den Kooperationspartnern AWI, WWF und der Universität Hamburg leistet einen wichtigen Beitrag, um den Wissenstransfer zwischen Forschung und Gesellschaft zu stärken.
UNESCO-Auszeichnung für Fortbildungskurs „klimafit“
Reklim: Klimafit – Klimawandel vor unserer Haustür und was kann ich tun?
Website Fortbildungskurs klimafit
NDR Info Redezeit: Sturmflut – Zerstörung – hohe Kosten: Wie kann sich der Norden schützen?
Am 02.11.2023 war Prof. Dr. Beate Ratter zu Gast in der Radiosendung “NDR Info Redezeit: Sturmflut – Zerstörung – hohe Kosten: Wie kann sich der Norden schützen?”. Hier diskutierten Fachleute und Hörer über die schwere Sturmflut am 20. Oktober 2023, die an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns zu Überschwemmungen, Deichbrüchen und Schäden in Millionenhöhe geführt hat. Weitere Gäste waren Dr. Fabian Geyer, Oberbürgermeister von Flensburg, und Tobias Goldschmidt, Minister für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur. Die Diskussionsbeiträge drehten sich um die neue Realität an deutschen Küsten und darüber, wie man sich künftig vor solch schweren Sturmfluten schützen kann. Der Videomitschnitt der Sendung ist bis 02.11.2025 verfügbar.
Videomitschnitt NDR Info Redezeit: Sturmflut – Zerstörung – hohe Kosten: Wie kann sich der Norden schützen?
Der Meeresspiegel und die Vertreibung aus dem Paradies
Eine Folge im Podcast “Klima, Mensch, Wandel”
Prof. Dr. Beate Ratter ist eine der weltweit führenden Inselforscherinnen und weiß, dass man die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit akzeptieren muss. Wenn man wirkungsvoll gegen den Klimawandel etwas unternehmen will, sollte man lernen, wie die Menschen auf Norderney oder auf den Seychellen ticken. In dieser Folge räumt sie mit falschen Vorstellungen zu vermeintlichen Inselparadiesen auf und erzählt, wer in Sachen ansteigender Meeresspiegel von wem lernen kann.
Podcast Folge "Der Meeresspiegel und die Vertreibung aus dem Paradies"
Versinken wir im Meer?
Auf dem Sender arte wurde am 25.06. aus der Reihe “42 – Die Antwort auf fast alles” eine Dokumentation zum Meeresspiegelanstieg ausgestrahlt. Im Beitrag vermitteln Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen sehr anschaulich anhand von Versuchen und Hintergrundinformationen, wie komplex das Thema “Meeresspiegelanstieg” ist. Prof. Dr.-Ing. habil. Torsten Schlurmann vom Franzius-Institut Hannover, Dr. Aimée Slangen (NIOZ), Dr. Sönke Dagendorf (Tulane Uni, New Orleans) und Prof. Dr. Beate Ratter, Leiterin der Abteilung Sozioökonomie des Küstenraumes am Helmholtz-Zentrum Hereon, erklären Zusammenhänge und veranschaulichen sie an Beispielen – positiv wie negativ.
arte Dokumentation: Versinken wir im Meer?
Klimarisiko Meer - Wenn die Flut kommt
Ist der durch den Klimawandel beschleunigte Meeresspiegelanstieg noch aufzuhalten? Was passiert im schlimmsten Fall? Die zdf Dokumentation ist in der Serie „planet e“ diesen Fragen nachgegangen und hat mit Wissenschaftlern gesprochen, die bereits seit Jahren vor einem Worst-Case-Szenario warnen.
Prof. Dr. Beate Ratter zeigt mit anderen Wissenschaftlern in der Dokumentation auf, welche Konsequenzen der beschleunigte Meeresspiegelanstieg hat. Anhand von Beispielen wie New York, Venedig und Hamburg werden die Zusammenhänge für verheerende Folgen dargestellt.
zdf Dokumentation "Klimarisiko Meer - Wenn die Flut kommt"
Integriertes Küstenmanagement
Erarbeitung von Analysemethoden, die – über die Verbindung von natur- und sozialwissenschaftlichen Informationen – zu einer integrierten und disziplinübergreifenden Betrachtung von Mensch/Natur-Interaktionen in Küstenräumen beitragen. Die Ergebnisse unterstützen die praktische Umsetzung von Küstenmanagementstrategien.
Planung und Governance im Küsten- und Meeresraum
Forschung zu traditionellen und neuen Planungsansätzen, insbesondere mit Blick auf Interessenkonflikte, die Langzeitentwicklung maritimer Nutzungen sowie Planungs- und Beteiligungsprozesse. Politik- und Akteursanalysen identifizieren Mechanismen, Regeln und Handlungsebenen, die für die Umsetzung von Meeresraumordnung und umweltpolitischen Maßnahmen relevant sind.
Wahrnehmung von Umweltveränderungen und Risiken an der Küste
Forschung zur Wahrnehmung des Meeresraumes und der Küstenlandschaft durch die ansässige Bevölkerung, insbesondere zur Bedeutung von Heimat und zur Wahrnehmung von Risiken. Die unterschiedlichen Wertvorstellungen und Wahrnehmungen von Risiken der Küstenbevölkerung spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung zukünftiger Planungs- und Managementstrategien.
Komplexe Systeme
Die Komplexitätstheorie trägt zu einem besseren Verständnis von nicht-linearen, dynamischen Systemen bei. Nicht die Vielzahl der Systemelemente steht im Vordergrund der Betrachtung, sondern das komplexe Verhalten von Systemen, die sowohl aus einfachen und wenigen als auch aus vielen und komplizierten Strukturen bestehen können. Die Komplexitätstheorie bietet neue Perspektiven auf den Systemverlauf, auf Unsicherheiten und Überraschungen sowie auf tipping points im Systemverhalten.
Sie kann helfen, neue Perspektiven und Ansätze zu entwickeln, um mit den Aufgaben des Umwelt- und Katastrophenmanagements umzugehen.
Ökosystemdienstleistungen
Ökosystemdienstleistungen beschreiben den Nutzen von Ökosystemen für den Menschen. Das Konzept kann über die Möglichkeit, ökologischen Gütern einen (materiellen) Wert beizumessen, die vielfältigen menschlichen Abhängigkeiten von funktionierenden Ökosystemen hervorheben. Es wird u. a. dazu genutzt, den Einfluss menschlichen Handels auf Ökosysteme und dessen Rückwirkung auf den Menschen zu analysieren.
Quantitative und qualitative empirische Methoden
Quantitative und qualitative Methoden der empirischen Sozialforschung dienen dazu, Mensch/Natur-Beziehungen im Küstenraum zu untersuchen. Quantitative Befragungen zeigen, wie die Bewohner der Küste ihre natürliche Umwelt und soziale Lebenswelt wahrnehmen und welche Interaktionen bestehen.
Qualitative Interviews mit Experten und Entscheidungsträgern ermöglichen ein tiefer gehendes Verständnis von Managementprozessen und institutionellen Rahmenbedingungen, die den Küstenraum betreffen.
Dynamische Simulation
Für die Untersuchung dynamischer sozialer Phänomene wird die Simulation als analytische Methode genutzt. Dabei werden räumliche und zeitliche Aspekte mit menschlichen Verhaltensparametern kombiniert, um unterschiedliche Prozesse und deren Konsequenzen zu analysieren. Empirische und/oder statistische Daten werden für die Erstellung von „was-wäre-wenn-Szenarien“ verwendet, um verschiedene Entwicklungspfade und komplexe Mensch/Natur-Interaktionen in Küstenräumen besser zu verstehen. Die Ergebnisse der Modellierungen können Diskussionen zwischen Wissenschaft, Administration und Öffentlichkeit initiieren.
Vergleichende Studien
Vergleichende Fallstudien zwischen Ländern und Kulturen mit unterschiedlichen natürlichen und sozialen Rahmenbedingungen geben Einsichten in Veränderungen und Entwicklungstendenzen.
Wir arbeiten eng mit Institutionen entlang der Nord- und Ostsee zusammen ebenso wie mit Partnern in Nordamerika, China, Taiwan und den karibischen Inselstaaten. Neben der aktiven Beteiligung an EU-fi nanzierten Forschungsprojekten kooperieren wir mit internationalen Netzwerken wie LOICZ und ICES.